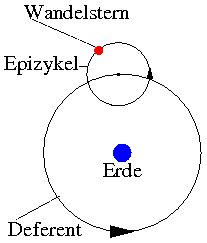Kurz-Info:
Eudoxos & Co. – Die Anfänge der wissenschaftlichen Astronomie
Die Anfänge der Astronomie
lagen in der Steinzeit (siehe z.B. Stonehenge). Die
Anfänge einer mit geometrischen Modellen arbeitenden
Astronomie liegen aber in der griechischen Antike. Hier wurde
erstmals versucht, die wundersamen Bahnen der Wandelsterne (Planeten)
mit geometrischen Modellen verstehbar zu machen. Da dabei auch nach
einer möglichst hohen quantitativen Genauigkeit der
geometrischen Modelle gestrebt wurde, bietet es sich an, diese
geometrischen Modelle der Griechen als den Anfangspunkt der
wissenschaftlichen Astronomie zu betrachten.
 Der
Reigen der beeindruckenden astronomischen Modelle der Griechen wurde
von Eudoxos (ca. 408 – 347 v.Chr.) eröffnet. Er entwirft insgesamt
sieben geometrische Modelle. Jedes dieser Modelle soll jeweils die
Position eines bestimmten Himmelskörpers (Sonne, Mond, Merkur,
Venus, Mars, Jupiter, Saturn) vorhersagen. Da diese Himmelsobjekte
(von der Erde aus betrachtet) teilweise recht wundersame Bahnen
nehmen, ist es für geozentrisch denkende Astronomen (wie es auch
Eudoxos war) nicht einfach, hier zu leistungsfähigen Modellen zu
gelangen. Eudoxos versucht es mit homozentrischen Kugeln: Mehrere
über ihre Drehachsen miteinander verbundene Kugeln, sollen es (durch
die Überlagerung ihrer verschiedenen Drehbewegungen) ermöglichen,
jeweils die Bahn eines bestimmten Himmelskörpers zu modellieren.
Der
Reigen der beeindruckenden astronomischen Modelle der Griechen wurde
von Eudoxos (ca. 408 – 347 v.Chr.) eröffnet. Er entwirft insgesamt
sieben geometrische Modelle. Jedes dieser Modelle soll jeweils die
Position eines bestimmten Himmelskörpers (Sonne, Mond, Merkur,
Venus, Mars, Jupiter, Saturn) vorhersagen. Da diese Himmelsobjekte
(von der Erde aus betrachtet) teilweise recht wundersame Bahnen
nehmen, ist es für geozentrisch denkende Astronomen (wie es auch
Eudoxos war) nicht einfach, hier zu leistungsfähigen Modellen zu
gelangen. Eudoxos versucht es mit homozentrischen Kugeln: Mehrere
über ihre Drehachsen miteinander verbundene Kugeln, sollen es (durch
die Überlagerung ihrer verschiedenen Drehbewegungen) ermöglichen,
jeweils die Bahn eines bestimmten Himmelskörpers zu modellieren.
Da die quantitative
Genauigkeit dieser Modelle noch nicht befriedigt, versucht
Kallippos (ca. 375 – 325 v.Chr.), die sieben Eudoxos Modelle zu
verbessern. Hierzu führt er in die Modelle jeweils eine weitere
(zusätzliche) homozentrische Kugel ein.
Diese von Kallippos
verbesserten Modelle wählt Aristoteles (384 – 322 v.Chr.) als
Ausgangspunkt für seine geozentrische Kosmologie. Aristoteles
integriert die sieben getrennten Modelle zu einem einzigen
umfassenden Modell. Diese geozentrische Kosmologie des Aristoteles
hat geistesgeschichtliche Wirkungen, die noch bis in die Renaissance
zu spüren sind.
 Die
griechische Astronomie war aber keineswegs durchgängig geozentrisch.
Aristarch von Samos (ca. 310 – 230 v. Chr.) ist der Kopernikus
der Antike. Er legt bereits im 3. Jahrhundert v.Chr. ein
heliozentrisches Weltbild vor. Allerdings gewinnt Aristarch
(Aristarchos) kaum Anhänger. Das hat nicht zuletzt mit zwei
(keineswegs dummen) Einwänden gegen das heliozentrische Modell zu
tun:
Die
griechische Astronomie war aber keineswegs durchgängig geozentrisch.
Aristarch von Samos (ca. 310 – 230 v. Chr.) ist der Kopernikus
der Antike. Er legt bereits im 3. Jahrhundert v.Chr. ein
heliozentrisches Weltbild vor. Allerdings gewinnt Aristarch
(Aristarchos) kaum Anhänger. Das hat nicht zuletzt mit zwei
(keineswegs dummen) Einwänden gegen das heliozentrische Modell zu
tun:
Wenn sich die Erde
einmal pro Jahr um die Sonne dreht, dann muss es eine parallaktische
Verschiebung der Fixstern-Positionen im Wechsel der Jahreszeiten
geben. Eine solche Parallaxe ist aber nicht messbar.
Wenn sich die Erde
einmal pro Tag um ihre eigene Achse dreht, dann müsste doch
unaufhörlich ein fürchterlicher Sturm aus östlicher Richtung
blasen. Tatsächlich können die Wolken am Himmel aber sowohl von
Ost nach West, wie von West nach Ost ziehen.
Heute können
wir die (winzige) parallaktische Verschiebung der Fixstern-Positionen
tatsächlich messen, und wir können erklären, warum wir von der
Eigendrehung der Erde so wenig mitbekommen. Aristarch konnte damals
weder das eine noch das andere. Und so blieb er mit seinem
heliozentrischen Weltbild ein Außenseiter.
Die
griechischen Astronomen nach Aristarch gehen in ihrer deutlich
überwiegenden Mehrheit weiterhin von einem geozentrischen Weltbild
aus.
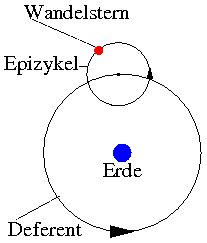 Die
geozentrische Astronomie der Antike gibt dabei allerdings den bisher
dominierenden Ansatz der homozentrischen Kugeln (Eudoxos, Kallippos,
Aristoteles) auf und wendet sich stattdessen einem anderen
geometrischen Ansatz zu: Man beschreibt die Bahnen der Wandelsterne
(Planeten) jetzt mit Hilfe von Deferenten und Epizyklen.
Die
geozentrische Astronomie der Antike gibt dabei allerdings den bisher
dominierenden Ansatz der homozentrischen Kugeln (Eudoxos, Kallippos,
Aristoteles) auf und wendet sich stattdessen einem anderen
geometrischen Ansatz zu: Man beschreibt die Bahnen der Wandelsterne
(Planeten) jetzt mit Hilfe von Deferenten und Epizyklen.
Die
Entwicklung des zweiten prominenten Ansatzes der geozentrischen
Astronomie der Antike beginnt mit Apollonios. Apollonios von Perge
(ca. 260 – 190 v.Chr.) forschte und lehrte in Alexandria. Als
überaus einflussreicher Mathematiker beschäftigt er sich auch mit
astronomischen Problemen. Er verwendet dabei Deferenten und Epizykel,
um die Bahnen von Himmelskörpern zu modellieren.
Hipparchos
von Nicaea (ca. 190 -125 v.Chr.) gilt als der bedeutendste
griechische Astronom. Er verbessert das von Apollonios vorgelegte
Modell entscheidend. So unterstellt er für die Sonnenbahn einen
Exzenter, einen Kreis, der zwar die Erde umspannt, dessen Mittelpunkt
aber außerhalb der Erde liegt. Mit dieser Konstruktion kann er die
Leistungsfähigkeit der geozentrischen Astronomie entscheidend
verbessern.
Für
den Schlusspunkt in der Entwicklung der griechischen Astronomie sorgt
Ptolemaios (ca. 100 – 160 n.Chr.). Sein heute Almagest
genanntes Hauptwerk Megale
Syntaxis
war die Krönung der geozentrischen Astronomie der Antike. Erst
Johannes Kepler (1571 – 1630) gelingt es, ein in puncto Genauigkeit
der Prognosen deutlich besseres astronomisches Modell vorzulegen. Bis
dahin war der Almagest
des Ptolemaios das unübertroffene Standardwerk der Astronomie.
Der
Text Eudoxos
& Co – Die Anfänge der wissenschaftlichen Astronomie
dokumentiert die Entwicklung dieser geometrischen Astronomie der
Griechen auf 32 Seiten. Zur
Veranschaulichung von Sachverhalten wurden etliche Abbildungen (meist
von
bescheidener
Qualität) in das PDF-Dokument eingebunden.
 Das
unter www.antike-griechische.de/Eudoxos.pdf
verfügbare PDF-Dokument unterliegt einer sehr liberalen Creative
Commons Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
Das
unter www.antike-griechische.de/Eudoxos.pdf
verfügbare PDF-Dokument unterliegt einer sehr liberalen Creative
Commons Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

 Der
Reigen der beeindruckenden astronomischen Modelle der Griechen wurde
von Eudoxos (ca. 408 – 347 v.Chr.) eröffnet. Er entwirft insgesamt
sieben geometrische Modelle. Jedes dieser Modelle soll jeweils die
Position eines bestimmten Himmelskörpers (Sonne, Mond, Merkur,
Venus, Mars, Jupiter, Saturn) vorhersagen. Da diese Himmelsobjekte
(von der Erde aus betrachtet) teilweise recht wundersame Bahnen
nehmen, ist es für geozentrisch denkende Astronomen (wie es auch
Eudoxos war) nicht einfach, hier zu leistungsfähigen Modellen zu
gelangen. Eudoxos versucht es mit homozentrischen Kugeln: Mehrere
über ihre Drehachsen miteinander verbundene Kugeln, sollen es (durch
die Überlagerung ihrer verschiedenen Drehbewegungen) ermöglichen,
jeweils die Bahn eines bestimmten Himmelskörpers zu modellieren.
Der
Reigen der beeindruckenden astronomischen Modelle der Griechen wurde
von Eudoxos (ca. 408 – 347 v.Chr.) eröffnet. Er entwirft insgesamt
sieben geometrische Modelle. Jedes dieser Modelle soll jeweils die
Position eines bestimmten Himmelskörpers (Sonne, Mond, Merkur,
Venus, Mars, Jupiter, Saturn) vorhersagen. Da diese Himmelsobjekte
(von der Erde aus betrachtet) teilweise recht wundersame Bahnen
nehmen, ist es für geozentrisch denkende Astronomen (wie es auch
Eudoxos war) nicht einfach, hier zu leistungsfähigen Modellen zu
gelangen. Eudoxos versucht es mit homozentrischen Kugeln: Mehrere
über ihre Drehachsen miteinander verbundene Kugeln, sollen es (durch
die Überlagerung ihrer verschiedenen Drehbewegungen) ermöglichen,
jeweils die Bahn eines bestimmten Himmelskörpers zu modellieren. Die
griechische Astronomie war aber keineswegs durchgängig geozentrisch.
Aristarch von Samos (ca. 310 – 230 v. Chr.) ist der Kopernikus
der Antike. Er legt bereits im 3. Jahrhundert v.Chr. ein
heliozentrisches Weltbild vor. Allerdings gewinnt Aristarch
(Aristarchos) kaum Anhänger. Das hat nicht zuletzt mit zwei
(keineswegs dummen) Einwänden gegen das heliozentrische Modell zu
tun:
Die
griechische Astronomie war aber keineswegs durchgängig geozentrisch.
Aristarch von Samos (ca. 310 – 230 v. Chr.) ist der Kopernikus
der Antike. Er legt bereits im 3. Jahrhundert v.Chr. ein
heliozentrisches Weltbild vor. Allerdings gewinnt Aristarch
(Aristarchos) kaum Anhänger. Das hat nicht zuletzt mit zwei
(keineswegs dummen) Einwänden gegen das heliozentrische Modell zu
tun: